Medienrecht
Home › Medienrecht › News zu Medienrecht

VG Wort: Wird der BGH Regeln zur Herausgebervergütung verwerfen?
- 23.04.2024
Die VG Wort hat jahrelang das für Urheber eingesammelte Geld auch an Herausgeber ausgeschüttet. In der bisherigen Form zu Unrecht, urteilt das OLG München. Nun muss der BGH sich ab Juli mit dem Fall befassen. Der Bundesgerichtshof (BGH) wird ab dem 25. Juli 2024 darüber zu entscheiden haben, ob die […]

,,Manta Manta – Zwoter Teil‘‘: Drehbuchautor bekommt 35.000 Euro von Constantin Film
- 22.04.2024
Der Drehbuchautor von “Manta Manta” Stafan Cantz klagt gegen die 2023 erschienene Fortsetzung des Til-Schweiger-Films „Manta Manta – Zwoter Teil“. Vor Gericht kam es nun zu einem Kampf David gegen Goliath, denn auf der anderen Seite stand kein geringerer Gegner als Constantin. Vor dem LG Hamburg wurde bereits 2023 eine […]

Kein Pastiche: YouTube-“Lehrvideo”verletzt Rechte an Heinrich Böll-Kurzgeschichte
- 19.04.2024
Jeder Schüler dürfte in seiner Laufbahn wohl mindestens einen Lehrer gehabt haben, der sich sehr kreative Methoden hat einfallen lassen, um den Stoff bestmöglich an seine Klasse zu vermitteln. Einem dieser Lehrer brachte die eigene Kreativität nun ein Rendezvous mit dem LG Köln ein. Der Grund: Er erstellte ein Video […]
Soforthilfe vom Anwalt
Sie brauchen rechtliche Beratung? Rufen Sie uns an für eine kostenlose Ersteinschätzung oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Sieg vor BVerfG: Julian Reichelts Taliban-Spruch war doch zulässige Kritik
- 17.04.2024
Das Bundesverfassungsgericht hat den umstrittenen Tweet von Ex-BILD-Chefredakteur Julian Reichelt nun gestattet. Wo das KG Berlin zuvor noch eine zulässige Meinungsäußerung verneinte, gab das BVerG der Verfassungsbeschwerde Reichelts nun statt. Ein Sieg vor dem höchsten deutschen Gericht und eine möglicherweise weitreichende Grundrechtsentscheidung in Sachen Staatskritik. Neben einem Beitrag in der […]

Nach Treffen von Rechten in Potsdam: Correctiv gewinnt gegen Vosgerau vor dem OLG Hamburg
- 04.04.2024
Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der an dem Geheimtreffen von Rechten und Rechtsextremen in Potsdam teilgenommen hat, hat nun vollumfänglich vor dem OLG Hamburg gegen Correctiv verloren. Es ging um die Darstellung seiner Aussagen in dem Bericht “Geheimplan gegen Deutschland”. Das OLG Hamburg nutzte in diesem und einem Parallelverfahren die Gelegenheit, […]

Schluss mit Schikane-Verfahren: EU beschließt Richtlinie gegen „SLAPP“-Klagen
- 20.03.2024
Die EU-Staaten haben der Anti-SLAPP-Richtlinie nun grünes Licht gegeben. Das Gesetz soll Journalisten, Aktivisten und Wissenschaftler vor unbegründeten Einschüchterungsklagen (sog. „SLAPP“-Klagen) schützen. Experten sehen einen Vorstoß für die Pressefreiheit und gegen Desinformation. Wer sich journalistisch in Sachen Grundrechte, Wissenschaft, Anti-Korruption und -Desinformation engagiert, hatte in den vergangenen Jahren immer häufiger […]

Zulässige Verdachtsberichterstattung: Unternehmer muss Presse-Artikel über seine Verurteilung hinnehmen
- 13.03.2024
Das OLG Zweibrücken hat bestätigt, dass in einer Tageszeitung zulässig über die Verurteilung eines lokalen Bauunternehmers berichtet wurde. Anlass war eine bevorstehende Wahl und der Umstand, dass er mit zwei Kandidaten verwandt ist. Der Unternehmer muss den Pressebericht über seine Verurteilung hinnehmen. Wenn ein lokaler Bauunternehmer mit Kandidaten einer bevorstehenden […]

LG Hamburg im Eilverfahren: Zweiter Antrag gegen Correctiv vollständig abgewiesen
- 29.02.2024
Ein AfD-Großspender, der auf dem Potsdamer Treffen von Rechten und Rechtsextremen nur als Spender erwähnt wurde, wollte seinen Namen aus dem Bericht streichen lassen. Wenigstens aber sollte Correctiv die Darstellung, wie und für wen er gespendet hatte, aus dem Artikel streichen. Das LG Hamburg hat den Eilantrag nun abgewiesen. Die […]

LG Hamburg entscheidet über Eilantrag: Teilsieg für Correctiv gegen Vosgerau
- 28.02.2024
Die Entscheidung des LG Hamburg in Sachen Vosgerau vs. Correctiv anlässlich des Artikels “Geheimplan gegen Deutschland” fällt 2:1 zugunsten des Recherchemagazins aus. Das Gericht nutzte die Gelegenheit, um deutlich auf die begrenzte Bedeutung des Verfahrens hinzuweisen. Das Landgericht (LG) Hamburg hat im medial stark diskutierten Eilverfahren des Juristen Dr. Ulrich […]

Nach Veröffentlichung von Gerichtsbeschlüssen: FragDenStaat-Chefredakteur Arne Semsrott angeklagt
- 20.02.2024
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat FragDenStaat-Redakteur Arne Semsrott wegen des Veröffentlichens von Gerichtsdokumenten angeklagt. Die GFF, die ihn unterstützt, hält dagegen: Grundlage für die Strafverfolgung sei eine verfassungswidrige Strafnorm, die die Pressefreiheit gefährde. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen Arne Semsrott, Chefredakteur von FragDenStaat, wegen der verbotenen Mitteilung über Gerichtsverhandlungen gem. § […]

“Beewashing-Honey”: Imker darf mit Böhmermann-Foto werben
- 14.02.2024
Weil Jan Böhmermann ihn in seiner Sendung – ohne Vorabinformation – des „Greenwashings“ diskreditiert hatte, schlug der Imker zurück: Er verwendete Böhmermanns Foto, um damit satirisch für seinen „Beewashing-Honey“ zu werben. Das durfte er, sagt nun das LG Dresden im Eilverfahren. Das Landgericht (LG) Dresden hat im einstweiligen Verfügungsverfahren die […]

AfD scheitert mit Eilantrag: Verfassungsschutz-Passage bleibt vorerst erlaubt
- 07.02.2024
Rund 10.000 Mitglieder der AfD sollen laut eines Verfassungsschutzberichts aus dem Jahr 2022 rechtsextrem sein könnten. Entsprechende Passagen im Bericht hat das VG Berlin nun nicht untersagt, da es dafür ausreichende Anhaltspunkte gebe. Das Bundesministerium des Innern (BMI) muss den Verfassungsschutzbericht des Bundes für das Jahr 2022 wegen darin enthaltener […]

Erfolg für Kunststar: Löwentraut nicht mehr an Galerie-Vertrag mit Geuer & Geuer gebunden
- 23.01.2024
Wenn bunte Kunst auf graues Recht trifft, entstehen schnell Konflikte. So war es im Fall des deutschen Künstlers Leon Löwentraut, der sich mit einem Kooperationsvertrag an eine Düsseldorfer Galerie gebunden hatte. Diesen konnte er nun beenden, obwohl die Kündigung vertraglich ausgeschlossen war. Das LG Düsseldorf fand einen Weg. Der Schlüssel […]

Wettskandal im Profifußball: Ex-DFB-Schiedsrichter muss Gutachter-Äußerungen über sich hinnehmen
- 08.12.2023
Der Wettskandal von 2005 gilt auch heute noch als einer der größten Skandale im deutschen Profifußball. Und auch heute noch beschäftigen sich Gerichte mit den Geschehnissen von damals. Ein ehemaliger Schiedsrichter zog nun vor Gericht, weil ihm Äußerungen aus einem Gutachten, das der DFB damals von einem Gutachter hat anfertigen […]

Bußgelder gegen Unternehmen: Bundesnetzagentur darf in Pressemitteilung Unternehmen nicht namentlich nennen
- 08.12.2023
Die Bundesnetzagentur darf keine Pressemitteilung veröffentlichen, in der sie unter namentlicher Nennung des betroffenen Unternehmens über den Erlass eines Bußgeldbescheides unterrichtet. Dies habe laut VG Köln eine anprangernde Wirkung und verletze das Grundrecht der Berufsfreiheit. Sofern die Bundesnetzagentur die Öffentlichkeit über Bußgelder unterrichten will, die sie gegen Unternehmen verhängt hat, […]

Facebook-Schmähkritik: „Stück Hirn-Vakuum“ nicht von Meinungsfreiheit gedeckt
- 30.11.2023
Wann eine Äußerung auch rechtlich zu weit geht, ist immer von Einzelfall und Kontext abhängig. Dass das LG Heilbronn die Äußerung eines Facebook-Nutzers, der die SPD-Politikerin Sawsan Chebli unter anderem mit „Hirn-Vakuum“ beleidigte, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt sah, kam für viele überraschend. Chebli ließ das Urteil nicht auf sich […]

Boris Becker vs. Oli Pocher: Pocher darf TV-Szenen nicht mehr zeigen
- 28.11.2023
Sieg für Boris Becker: Ein Beitrag aus der Sendung des Comedian Oliver Pocher darf nicht mehr gezeigt werden. Darin sei Becker ins Lächerliche gezogen worden. Das aber müsse sich die Ex-Tennislegende nicht gefallen lassen, so das OLG Karlsruhe. Als hätte Comedian Oliver Pocher nach der Trennung von seiner Frau Amira […]
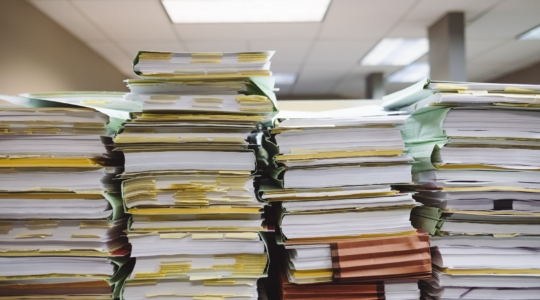
Mord an Familie von Albert Einstein: Autor darf Akten zu Einstein-Mord einsehen
- 21.11.2023
An der Aufarbeitung der Morde, die im zweiten Weltkrieg durch deutsche Soldaten begangen wurden, besteht laut VG Neustadt ein überragendes öffentliches Interesse. Deshalb sei auch einem britischen Journalisten die Einsicht in die Ermittlungsakte zur Ermordung der Familie Robert Einsteins, eines Cousins Albert Einsteins, zu gewähren. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) ist […]

Diskussionskultur auf X: Transfrau muss „#DubistEinMann“-Kommentar hinnehmen
- 09.11.2023
Der Kommentar #DubistEinMann auf der Plattform X kann eine zulässige Meinungsäußerung sein, so das OLG Frankfurt. Geklagt hatte die Transaktivistin Julia Monro, die einen Tweet des Deutschen Frauenrats zum Selbstbestimmungsgesetz geteilt und um Unterstützung dafür geworben habe. In einer Antwort auf ihren Tweet wurde der Hashtag „DubistEinMann“ verwendet. Die Diskussionskultur […]

Verletzung der Menschenwürde: Darf ein TV-Sender einen epileptischen Anfall zeigen?
- 19.10.2023
„Gaffer“, also Schaulustige, die ein für sie spannendes Geschehen aus Neugier beobachten, gibt es an fast jeder Unfallstelle. Durch das Schießen von Fotos oder durch Filmaufnahmen kann man das Persönlichkeitsrecht der jeweiligen Unfallopfer verletzen. Oftmals stören und behindern die Zuschauer eines Unfalls auch die Rettungskräfte. Letzteres ist bei den Zuschauern […]

Schufa & Bonify haben WBS verklagt: Wie dürfen wir die Bonify-Sicherheitslücke nennen?
- 17.10.2023
Eine Angelegenheit in eigener Sache: Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv damit auseinandergesetzt und rechtlich diskutiert, wie wir das unbestrittene, zeitweilig vorhandene Sicherheitsproblem bei der Schufa-Tochter Bonify nennen dürfen. Um diese Frage haben wir uns sowohl mit der Schufa als auch mit ihrer Tochter Bonify vor mehreren Gerichten […]

Presserechtsstreit: Spiegel und SZ erzielen Erfolge in der Causa Lindemann
- 11.10.2023
Neben dem Hauptverfahren zur Spiegel-Berichterstattung im Fall Till Lindemann ist nun ein Ableger der Streitigkeit entschieden worden. Während dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel in der Hauptsache bestimmte Passagen untersagt worden sind, beanstandete das Magazin nun wiederum erfolgreich Passagen einer Pressemitteilung der Kanzlei Schertz Bergmann, die Lindemann gerichtlich vertritt. Auch in einem […]

Verdachtsberichterstattung: Böhmermann-Produktionsfirma siegt gegen Reichelt
- 10.10.2023
Der ehemalige „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt erhob in der Schönbohm-Affäre schwere Vorwürfe gegen Jan Böhmermann. In dem Rechtsstreit entschied das LG Hamburg nun, dass Reichelt keine Unwahrheiten mehr über das „ZDF Magazin Royale“ verbreiten darf. Jan Böhmermann berichtete in der Sendung des „ZDF Magazin Royale“ vom Oktober 2022 über den früheren […]

Kontosperrung: Facebook muss trotz Entsperrung die Prozesskosten tragen
- 05.10.2023
Wenn das eigene Facebook-Konto durch das Unternehmen deaktiviert wurde, kann das lästig sein. Noch lästiger ist es aber, wenn das Konto erst freigegeben wird, nachdem ein Gerichtsverfahren eingeleitet wurde, Facebook aber die Kosten für den Anwalt und das Verfahren nicht tragen will. Kann Facebook in solchen Fällen zur Kasse gebeten […]

Kein Netzempfang: Hohe Entschädigungen bei Mobilfunkstörung möglich
- 05.10.2023
Mobilfunkstörungen sind ärgerlich für die Kunden – insbesondere dann, wenn sie monatelang andauern. Auch für den Mobilfunkanbieter selbst sind solche Störungen ein Problem, weil sie Entschädigungen für die Kunden rechtfertigen können. Ein Kunde zog vor das LG Göttingen, weil eine monatelange Netzstörung durch seinen Anbieter nicht behoben wurde. Er forderte […]

OLG Braunschweig sieht keine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung: „Ungeimpft“-Stern auf Facebook gepostet
- 26.09.2023
Nach dem AG Pirna hat nun auch das OLG Braunschweig einen Facebook-Nutzer, welcher einen „Judenstern“ mit dem Wort „Ungeimpft“ postete, freigesprochen. Eine Strafbarkeit wegen Volksverhetzung sei nicht gegeben, da der Post im konkreten Fall nicht geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu stören. Auf Corona-Demos und im Internet kommt es immer […]

Unzulässige Verdachtsberichterstattung: Botschafter geht gegen Spiegel und MDR vor
- 06.09.2023
Kaum in einer Zeit waren die Grundsätze der identifizierenden Verdachtsberichterstattung so relevant wie heute. Der BGH schärft in einer Entscheidung über eine Persönlichkeitsrechtsverletzung eines ausländischen Diplomaten erneut die konkreten Zulässigkeitsvoraussetzungen. Eine identifizierende Verdachtsberichterstattung fordert einen Mindestbestand an Beweistatsachen, die für die Richtigkeit der Information sprechen und ihr damit erst „Öffentlichkeitswert“ […]

Verletzung der Rundfunkfreiheit: Wohnungsdurchsuchung bei zwei Radio-Redakteuren rechtswidrig
- 31.08.2023
Die Staatsanwaltschaft hat die Redaktionsräume von Radio Dreyeckland und die Wohnungen zweier Redakteure durchsucht, weil der Radiosender die verbotene Plattform linksunten.indymedia in einem Online-Artikel verlinkt hatte. Die Durchsuchung verletzte die Rundfunkfreiheit, entschied nun das LG Karlsruhe. Das Landgericht (LG) Karlsruhe hat drei Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts (AG) Karlsruhe in den Räumen […]

VG Minden: YouTuber ist Journalist – sogar bei Berichterstattung in eigener Sache
- 30.08.2023
Ab wann ist man in Zeiten von YouTube und anderen sozialen Medien schon ein Journalist? Zwar war diese Frage nicht der Hauptkern der Verhandlung vor dem VG Minden, dennoch spielte sie eine nicht unwesentliche Rolle. Ein YouTuber suchte gerichtlichen Schutz, weil ihm verboten werden sollte, über seinen anstehenden Gerichtstermin in […]

BVerfG bricht mit umstrittener Praxis: Keine Vorabinformationen mehr für ausgewählte Journalisten
- 29.08.2023
Ungerecht, unangemessen und unseriös – so könnte man die bisherige Vorabinformationspraxis des BVerfG bezeichnen. Danach erhielten ausgewählte Journalisten vorab Zugang zu Pressemitteilungen über noch nicht verkündete Urteile. Damit ist nun Schluss. Ab dem 1. September 2023 werden Entscheidungen für alle Journalisten nur noch in einer wöchentlichen Vorschau auf der Internetseite […]

Mieses TV-Programm: Rundfunkbeitrag wegen „schlechten Programminhalten“ verweigern?
- 22.08.2023
18,36 Euro – so viel zahlt jeder Haushalt in Deutschland monatlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dass nicht alle Beitragszahler glücklich darüber sind, monatlich den Rundfunkbeitrag entrichten zu müssen, ist in Zeiten von Social Media kein Geheimnis. Eine Beitragszahlerin war jedoch so unzufrieden, dass sie den Weg zum VGH München suchte. […]

Urteil im Fall Julian Reichelt: Quellenschutz nur mit Vereinbarung
- 13.07.2023
Wie weit reicht der Quellenschutz tatsächlich? Darüber entschied nun das LG Berlin. Geklagt hatte kein Unbekannter: Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt ging dagegen vor, dass von ihm weitergegebene interne Informationen aus dem Springer-Konzern nicht geheim gehalten wurden und er als deren Quelle offengelegt wurde. Ist der ehemalige Chefredakteur dadurch in seinem Persönlichkeitsrecht […]